Einer Sagengestalt, einem Freiheitskämpfer, einem, den es gar nie gab und den trotzdem jedes Kind kennt, einen ganze Roman zu widmen, ist an sich schon eine mutige Tat. Ein literarischer Apfelschuss, gewissermassen. Joachim B. Schmidt erzählt die vielfach genutzte Vorlage des trutzigen Wilhelm Tell ganz neu, modern und nah am Menschen.
Den alten Spruch, dass keiner wisse, ob Tell je gelebt, sicher sei einzig, dass er den Gessler erschossen habe, mag kein Geschichtslehrer mehr hören. Tell ist heute nicht mehr als ein Denkmal auf dem Dorfplatz von Altdorf, wird noch von Coronaleugnern zu einer Art Galionsfigur erhoben und wurde von Mani Matter als Stoff fürs Dorftheater besungen: «Sie hei dr Wilhelm Täll ufgfüert, im Leue z‹Nottiswil». Vorbei die Zeiten, als es im Kanton Zürich für alle Klassen der Oberstufe Pflicht war, einmal «Wilhelm Tell» im Schauspielhaus zu besuchen. Das Schillerdrama war zu diesem Zwecke jahrzehntelang im Repertoire des Theaters.
Also, den Tell kennen alle. Und da kommt ein vor vielen Jahren nach Island ausgewanderter Bündner, Joachim B. Schmidt, greift sich die alte Heldensage, baut um sie herum eine Geschichte – und erweckt den alten Tell zum Leben. Nicht als strammen Freiheitsheld mit geschulterter Armbrust und seinem Sohn im Gefolge, sondern als einen eher kleinen knorrigen, zweifelnden, vom harten Leben gebeutelten Bergbauer, menschenscheu und verbittert, der lieber einem Bär in die Berge hinauf nachsteigt, als mit jemandem zu reden.
Eintauchen in eine kalte Welt
Und dann passiert es: Die alte, vielfach gehörte Geschichte entfaltet einen Sog, nimmt einen mit in die raue Welt der Urnerberge, in das karge Leben der Bergbauern, in ihre Ängste, ihre Sorgen. Wilhelm Tell trauert nicht nur um seinen jüngeren Bruder Peter, der, und das wird erst zum Schluss des Buches deutlich, im seinem Beisein – und durch seine Schuld? – von einer Lawine mitgerissen wird und seitdem verschollen ist. Walter ist Peters Sohn und Hedwig war seine Frau. Auf dem abseits gelegenen Hof ist man aufeinander angewiesen. So nimmt Wilhelm Peters Stellung ein. Auf dem Hof, obwohl er lieber als Jäger verbotenerweise die Räucherkammer des Hauses füllt, und im Bett bei Hedwig, die ihm zwei Kinder, Willi und die kleine Lotta schenkt.
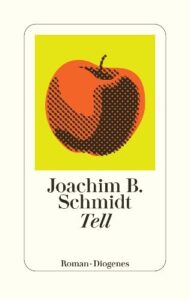
Ja, und da ist die Besatzungsmacht. Landvogt Gessler muss als Adliger die aufsässigen Bergler unter Kontrolle halten. Eine Aufgabe, die ihm unendlich zuwider ist. Er sehnt sich nach seiner Frau und seinem Kind, das er noch nie gesehen hat, schreibt und erhält lange Briefe und wird von seinem brutalen Schergen Harras nicht nur zutiefst verachtet, sondern auch zu Strafaktionen gezwungen, die er gar nicht verfügen will.
Einen Apfel vom Kopf des eigenen Kindes schiessen zum Beispiel. Und dann diesen unbotmässigen Tell doch festzunehmen und über den See nach Küssnacht ins Gefängnis zu überführen. Was gründlich misslingt. Das Boot sinkt mit Mann und Maus, obwohl weit und breit kein Sturm zu spüren ist – ausser in den Köpfen der Schergen, alkoholbedingt. Dass Tell gut schwimmen und sich retten kann, hat mit einem anderen Erzählstrang zu tun, der zunächst nur angedeutet und dann immer konkreter wird.
Diese «andere» Geschichte
Die Geschichte mit der hohlen Gasse lässt Schmidt gleich beiseite. Auf einem Schneefeld verwundet Tell Gessler tödlich und kämpft dann mit Harras um sein eigenes Leben. Mit einem Pfeil im Leib rettet er sich ins Pfarrhaus, wo ihn Pfarrer und Haushälterin als ihresgleichen aufnehmen. Nicht dem Stand nach, aber er hat als Bub dasselbe erlebt wie auch der Pfarrer: das Unaussprechliche, das der verstorbene frühere Seelsorger mit und an ihnen verübte. Und Frau Furrer, die Haushälterin, kann auch nach 20, 30 Jahren noch nicht darüber sprechen, hat aber immerhin mitgelitten.
Apropos sprechen: Der ganze Roman ist eine Art Zeugenaussage. Alle kommen zu Wort, erzählen aus ihrer Sicht. Tell bleibt lange stumm, bis fast zum Ende. Des Romans und seines Lebens. So ist auch die Sprache: Bäurisch herb manchmal, die Emotionen hinter einfachen Sätzen verborgen, roh und brutal die des Menschenverächters und Vergewaltigers Harras, fast schon melancholisch die des Landvogts wider Willen Gessler.
 Hohe Berge, schroffe Felsen – das ist die Welt des Wilhelm Tell. (pixabay)
Hohe Berge, schroffe Felsen – das ist die Welt des Wilhelm Tell. (pixabay)
Dass man die Geschichte dieses Wilhelm Tell fast nicht mehr aus der Hand legen mag, kann nicht am Stoff an sich liegen. Der wurde spätestens seit dem 15. Jahrhundert immer wieder mal aufbereitet, Tells Heldentat, die letztlich zur Befreiung der Innerschweiz vom Joch der Besatzer führte, immer wieder besungen, dramatisiert oder ironisch beschrieben. Letzteres von Max Frisch.
Hier aber wird ein historisches Gemälde skizziert, das einem literarischen Wimmelbild gleicht: Viele Details, wie die selber auf den Viehmarkt schwimmende Kuh, Tells Marsch ins Tal mit der toten Mutter auf den Armen oder die Vertreibung eines Bären mit Pfannen und Geschrei – manches nur unscharf angedeutet, anders in klaren Farben geschildert. Es ist ein Roman über die Menschen, die zwischen schroffen Felsen mit harten Wintern leben, geschrieben von einem, der in Island zwischen schroffen Felsen und mit harten Wintern lebt.
Joachim B. Schmidt: Tell. Diogenes Verlag, 2022. ISBN 978-3-257-07200-6

Spannend und interessant, diese literarische Verarbeitung des Tell-Mythos! Als Gegensatz ebenso interessant und spannend ist die geschichtswissenschaftliche Auseinandersetzung, die Jean-François Bergier 1988 in Paris französisch veröffentlichen liess. Eine bearbeitete Neuauflage (deutsch) erschien 2012 im Römerhof Verlag Zürich und wurde im September oder Oktober 2012 im Seniorweb rezensiert.